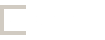Anna Seghers, "Das siebte Kreuz", 1942
Anna Seghers, "Das siebte Kreuz", 1942
Das siebte Kreuz
Anders. So fühlte sich mein neues Leben an. Sehr anders sogar. Es wäre untertrieben gewesen, zu behaupten, dass irgendetwas gleich geblieben war. Hier war es nicht wie in Frankreich. Hier war fast immer Winter, fast immer kalt. Der Schnee bedeckte alles wie ein Leichentuch und nahm der Welt den Sinn. Die Menschen, die hier lebten, erinnerten nicht im Entferntesten an die feinen Pariser mit ihrem singenden Französisch. Die Inuit unterhielten sich in einer in meinen Ohren abgehackten Sprache, die überhaupt keinen Sinn ergab. Die wenigen, mit denen ich mich auf Englisch oder Französisch verständigen konnte, waren nicht besonders hilfreich. Wenn ich nach dem nächsten Supermarkt fragte lachten sie schnatternd und deuteten in verschiedene, undefinierbare Richtungen. Außerdem war es hier nicht nur kalt, sondern kälter als kalt. Egal, in wie viele Jacken ich mich hüllte oder wie gut die Blechhütten gebaut waren, in denen ich hauste.
Deprimierenderweise fühlte ich mich im Exil, irgendwo im tiefsten Norden Kanadas, nicht besser als in Paris. Ich sehnte mich nach Frankreich, nach dem Eiffelturm und den vielen kleinen Läden, den Menschen, die ich verstand und die auch mich verstanden. Ich sehnte mich nach meiner kleinen Wohnung über einem Café und nach meinem stets unzufriedenen Chef. Immer wenn ich an meine alte Heimat dachte, tauchte sein Bild in meinem Kopf auf. Klein, mit einem gigantischen Schnurrbart und einem Anzug mit schlammgelber Krawatte. Er erschien immer in demselben Anzug, und zwar wirklich immer. Ich wusste nicht, ob er ihn jeden Tag wusch, oder wie er es fertig brachte, immer vorbildlich und hygienisch zu wirken. Zweifelsohne hatte sich sein Leben trotz der Nationalsozialisten nicht besonders geändert. Vor mir tauchte eines der Inuit-Kinder auf. Es starrte mich aus braunen Augen an. In seinem Blick lag Neugier und Scheu. Die meisten hier waren nicht so gut auf mich zu sprechen. Als ich hier angekommen war, hatte ich sie Eskimos genannt. So hatten sie immer geheißen, zumindest damals in Paris. Aber hier, hier war es eine Beleidigung.
Das Kind stupste mich an, dann zupfte es zögerlich an einer meiner vielen Jacken. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Schichten ich trug, ich wusste nur, dass es nicht genügend waren, um die beißender Kälte abzuhalten. Das Kind sah wieder zu mir auf und machte eine Geste in Richtung der Straße. Dann lief es los. Ich folgte ihm zögerlich, normalerweise hielten sich alle von mir fern. Sollten die Nationalsozialisten bis hierher kommen, würden sie mich sofort erkennen. Ich hatte weder das schwarze Haar und die dunkle Haut der Inuit noch sprach ich ihre Sprache oder trug ihre Kleidung. Und das machte mich zu einem Außenseiter.
Vielleicht waren Juden ja überall Außenseiter. Der Gedanke schoss mir durch den Kopf, bevor ich es verhindern konnte. Ein Teil von mir dachte: verbittert und voller Hass auf die Welt und einen Gott, der bisher noch nichts besonders viel getan hatte, um die Menschen dieser Welt zu retten, schließlich waren Juden auch Menschen, auch wenn sie nicht an meinen Gott glaubten und nicht an Christus, solch ein Schicksal verdiente niemand. Andererseits war alles noch gut gewesen, bis die Nazis gekommen waren. Ich hatte Freunde gehabt, christliche, jüdische und Anhänger anderer Religionen. Es war egal gewesen, hatte ich mir immer gesagt. Aber stimmte das auch? Inzwischen war ich mir nicht mehr sicher. Irgendwer hatte mich verraten und mich so zur Flucht gezwungen. Ich hatte nie erfahren, wer es gewesen war. Einer meiner Freunde, oder besser einer meiner falschen Freunde.
Inzwischen folgte mein Körper wie selbstverständlich dem jungen Inuit, während meine Gedanken irgendwo in weiter Ferne kreisten. Ich hatte fliehen müssen, nicht weil ich Jude war, sondern weil ich mich menschlich verhalten hatte. Ein Mann hatte Unterschlupf bei mir gesucht. Er war abgemagert gewesen, ohne Geld und in zerlumpten Kleidern. In seinen Augen hatte ich den Schmerz und den Kummer gesehen und die Angst, in der er lebte. Ich hatte sofort gewusst, wer er war. Er war derjenige, den alle suchten. Er war aus einem der Konzentrationslager geflohen. Ich hatte niemals erfahren dürfen wie ihm das gelungen war. Und nun stand ich dem Mann gegenüber und hörte sie kommen. Die Nazis. Ich wusste damals nicht, ob sie diesen Mann suchten oder nur zufällig vorbeikamen, aber das war egal gewesen. Der Blick aus diesen Augen hatte mich vergessen lassen, was passieren würde, wenn es jemand bemerkte. Und es würde jemand merken. Ohne ein Wort schloss ich meine Wohnungstür auf und winkte den Mann herein. Er ging ebenso stumm hinein, doch in seinen Augen konnte ich die Dankbarkeit sehen.
Draußen hörte ich Männer laufen. Ihre Schritte knirschten im Schnee und dann klopfte es. Ich zuckte zusammen und der Mann ebenfalls. Jetzt war alles aus. Ich machte eine stumme Geste zu dem Geflohenen und er verstand. Als ich die Tür öffnete, war die Diele leer. „Haben sie einen Mann gesehen, etwa eins achtzig groß, dunkle Haare, in schlechtem Zustand, ein Jude?“, das letzte Wort spie der Mann vor mir aus, als wäre es Dreck, und es war ja auch Dreck, zumindest in seinen Augen. „Nein.“, sagte ich mit fester, klarer Stimme; und mit dieser Antwort besiegelte ich mein Schicksal. Der Jude wurde nicht gefasst und ich hatte ihm geholfen. Ich wusste auch, was mich dazu bewog, es meinen Freunden zu erzählen. Alle lobten mich dafür, alle dachten so wie ich. Oder zumindest fast alle. Einer hatte mich an die Nazis verraten. Wenn ich nicht zufällig nicht zu Hause gewesen wäre, als sie mich festnehmen wollten. Meine Vermieterin hatte mich gewarnt. Ihr verdankte ich meine Freiheit, und ich betete zu Gott, dass es ihr gut ging.
„Sir?“, der Junge riss mich zurück in die Gegenwart, zurück in das kalte Kanada. Sein Englisch klang holprig und etwas abgehackt. Er lotste mich zu dem einzigen Verbindungspunkt in die Zivilisation. Dem Postamt. Ich betrat den Raum, er war klein und kalt und vollgestopft. Ein alter Mann stand hinter einem behelfsmäßigen Tresen und grinste mich zahnlos an. Er hielt mir ein Paket hin. Ich kannte den Absender nicht. Es war nicht besonders groß. Ich öffnete es gedankenverloren. In ihm befand sich ein Buch. Ich betrachtete es verwirrt. Wer schickte mir ein Buch? Das Buch selbst war relativ schlicht. Das Titelbild zeigte einen Wald, im Vordergrund einen Nazisoldaten, der zu einer Schlägerei im Hintergrund stürzte. „Das siebte Kreuz, Anna Seghers“, las ich den Titel leise vor. Dann überflog ich den Klappentext und stockte. Diese Geschichte kannte ich. Ich kam selbst in ihr vor. Ich war einer der Menschen, die Georg Heislers geholfen hatten. Ich verstand nicht, wie diese Geschichte zu einem Buch geworden war, aber zum ersten Mal freute ich mich wirklich über das, was ich getan hatte.
von Lea Horn
Anna Seghers
Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Schon seit Tagen herrscht in meinem Leben nur noch Eintönigkeit. Obwohl mir die Arbeit im Widerstandsverein viel Freude bereitet und auch meine Familie immer für mich da ist, fühle ich mich schwer und verloren. Ich kann es nicht ertragen, so zu leben, während zur gleichen Zeit irgendwo auf der Welt solch ein großes Leid herrscht. Ich will mich wehren, will allen anderen zeigen, dass es wichtig ist, zu kämpfen und nicht nur still zuzusehen. Doch es gelingt nicht. Mir gelingt gar nichts mehr. Ich bringe keinen Satz auf das Papier. Doch die Zeit drängt. In jeder Sekunde, die ich damit verbringe untätig herumzusitzen, müssen weitere Menschen sterben. Jeder Moment zerstört weitere Leben für immer. Und ich kann nichts dagegen tun. Auch ich bin schuldig an diesem großen Leid. Jeder einzelne von uns muss mit dem Wissen leben können, für diese Taten verantwortlich zu sein. Jeder, der wegsieht und jeder, der keinen Widerstand leistet. Ich stehe auf und verlasse das Haus. Draußen regnet es in Strömen. Der Regen setzt sich in mein Gesicht und auf meine Kleider. Er umgibt mich wie eine schützende Hülle und gibt mir für kurze Zeit ein Gefühl von Sicherheit. Doch dieses Gefühl trügt. Niemand ist noch sicher. Hinter jedem Gesicht kann sich ein Feind verbergen. Man verrät sogar den besten Freund.
Ich betrete das Gasthaus auf der anderen Straßenseite. Es ist brechend voll. Die feuchte und stickige Luft macht mir das Atmen schwer. Ich setzte mich an einen leeren Tisch, abseits der anderen. Ich habe hier keine Freunde, ich kann niemandem vertrauen. Niemand weiß, was sich hinter den Gesichtern derer versteckt, die sie zu sein scheinen. Ich kann mir keinen Fehler erlauben. Ein Fehler würde meinen Tod bedeuten. Ich bin hierher gekommen, um Inspiration zu finden. Um weiterzukommen. Doch es hilft nichts. In meinem Kopf ist eine Blockade, die keinen vernünftigen Gedanken hindurch lässt. Ich empfinde Abscheu gegenüber mir selbst. Das einzige, was ich kann, das einzige, was ich je konnte, das Schreiben, lässt mich im Stich. Es gibt nichts mehr worauf ich stolz sein kann.
Ein Mann setzt sich zu mir an den Tisch. Er sieht müde aus. Seine Augen erzählen von großem Elend, von schlimmen Taten, die er ansehen und miterleben musste. Sein Gesicht ist gezeichnet von Schmerz und Qual. Dieser Mann fasziniert mich. Er strahlt eine innere Stärke aus, die durch nichts und niemanden gebrochen werden kann. Doch ich traue mich nicht ihn anzusprechen. Ich habe Angst vor den Dingen, die er mir erzählen könnte. Angst vor Dingen, die auch mir selbst geschehen könnten. „Was wollen sie von mir?“, fragt er plötzlich. Er hat bemerkt, dass ich ihn die ganze Zeit anstarre.
„Ich will ihre Geschichte!“ Ich merke selbst, wie lächerlich ich klinge.
Doch trotzdem beginnt er mit leiser Stimme zu erzählen: „ Mein Name ist Gustav Heim. Ich bin Jude. Meine ganze Familie ist im Konzentrationslager gestorben. Ich bin geflohen. Aber trotzdem bin ich tot. Man hat mir mein ganzes Leben genommen, alles was mir wichtig war. Ich bin kein Mensch mehr, nur ein leere Hülle ohne Gefühle. Ich bin wie betäubt und fühle, dass ich nur noch funktioniere. Ich lebe nicht mehr.“ Seine Stimme versagt. Aber ich weiß, was zu tun ist.
von Veronika Lummer