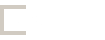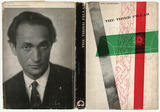Silvia Tennenbaum: Straßen von gestern (2012, orig. 1983)
Silvia Tennenbaum: Straßen von gestern (2012, orig. 1983)
Viele Nationen sind aufgestiegen und untergegangen, aber die Juden sind geblieben. Wir sind das Gewissen der Welt, niemand kann uns beseitigen.
Die Figur des Nathan Wertheim in Silvia Tennenbaums Roman Straßen von gestern
Der Gesellschaftsroman von Silvia Tennenbaum erzählt die Geschichte der Frankfurter liberalen jüdischen Familie Wertheim zwischen 1903 und 1945. Im Zentrum stehen der Bankier Eduard Wertheim und die Familien seiner vier Brüder mit ihren jeweils unterschiedlichen Lebensentwürfen. Ihr gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Aufstieg verhindert nicht, dass die Spielräume der Wertheims mit dem Erstarken des Nationalismus immer enger werden. Auf die Frage, ob man ins Exil gehen solle und wohin, reagieren die Einzelnen unterschiedlich. Die Familie von Eduards Großnichte Clara, einer Figur, die autobiografische Züge der Autorin trägt, flieht in die USA und erlebt, was es heißt, sich in einer neuen Kultur und Sprache zurechtzufinden und anzupassen. Erleichtert darüber, selbst gerettet zu sein, müssen Clara und ihre Eltern nach dem Ende des Kriegs jedoch auch damit leben, dass nicht alle Wertheims der Verfolgung entgehen konnten.
Als Silvia Tennenbaum den Roman schrieb, kannte sie ihre Geburtsstadt Frankfurt nur noch aus der Erinnerung. Erst mit dem Erscheinen der deutschen Übersetzung 1983 kehrte die Autorin zum ersten Mal nach der Emigration wieder dorthin zurück. In ihrem Essay Auschwitz and Life (1992) reflektiert sie diese Erfahrung: Auf der Suche nach den historischen Plätzen, inzwischen „halb vergessene Ecken und öde Gärten“, habe sie keinen Zugang zu ihrer Geburtsstadt mehr gefunden. Erst durch ihre Beschäftigung mit der Gegenwart Frankfurts, durch Kontakte zu Geschichtsinitiativen und Erinnerungsprojekten, wurde der durch das Exil verlorene Ort für die Schriftstellerin erneut als Heimat erfahrbar.