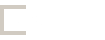Wegbeschreibungen. Ein Interview mit Emine Sevgi Özdamar, 2012
Wegbeschreibungen. Ein Interview mit Emine Sevgi Özdamar, 2012
Man sagt ja, Literatur ist Identitätssuche. Und […] die Identität sucht man in der Fremde anders als in seinem eigenen Land. Mich hat es immer interessiert, was heißt das, sich von einem Dorf auf den Weg machen? Was passiert mit den Menschen, die aus ihren Hierarchien rausgehen? Zu einer anderen Sprache gehen? Oder zu einer Sprachlosigkeit gehen? […] Was passiert mit der Sprache, wenn man durch diese Tür rein- und rausgeht? Und was passiert mit der Ästhetik des Landes, aus dem man gekommen ist?
Wegbeschreibungen, Interview mit Emine Sevgi Özdamar, 2012
Ein zentrales Thema in Emine Sevgi Özdamars Literatur ist die Sprache. Dabei setzt sie sich wiederholt mit der Bedeutung der Muttersprache beim Weg in eine neue Sprache auseinander. Was passiert, wenn sich zwei Sprachen begegnen? Und was, wenn man zwischen zwei Sprachen wechselt? Was wird aus Sprachbildern? Wie denkt man in einer anderen Sprache? Welche ästhetischen und inhaltlichen Auswirkungen hat die Sprache auf die Weltsicht? All diese Themen werden in dem Videointerview angesprochen. Özdamar erzählt von ihrem Zugang zum Deutschen; davon, wie sie die Sprache über die Theaterarbeit und die damit verbundene Körperlichkeit der gesprochenen Sprache auf der Bühne gelernt hat; und davon, wie sie die Unterschiede im geteilten Berlin der 1970er Jahre wahrgenommen hat.
In ihrem Roman Mutterzunge (2006) – der Titel ist die wörtliche Übersetzung des türkischen Wortes für Muttersprache – kreisen die ersten beiden Erzählungen, die titelgebende Geschichte Mutterzunge und Großvaterzunge darum, wie die Ich-Erzählerin nach ihrem Umzug von Istanbul nach Berlin die Verbindung zur türkischen Sprache verliert. Sie nimmt dies als schmerzhafte Erfahrung wahr, denn: „In der Fremdsprache haben Wörter keine Kindheit.“ Um wieder einen Zugang zur „Mutterzunge“ zu finden, beschließt sie daher, eine Generation weiter zurückzugehen und Arabisch zu lernen, die Sprache ihres Großvaters. Über diesen Umweg einer dritten Sprache fand sie aus der Sprachlosigkeit heraus und wurde, wie sie von sich sagt, zur „Wörtersammlerin“.